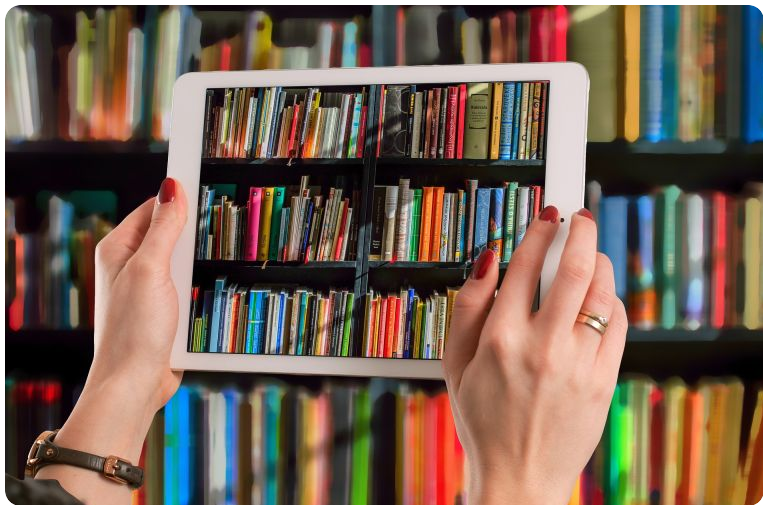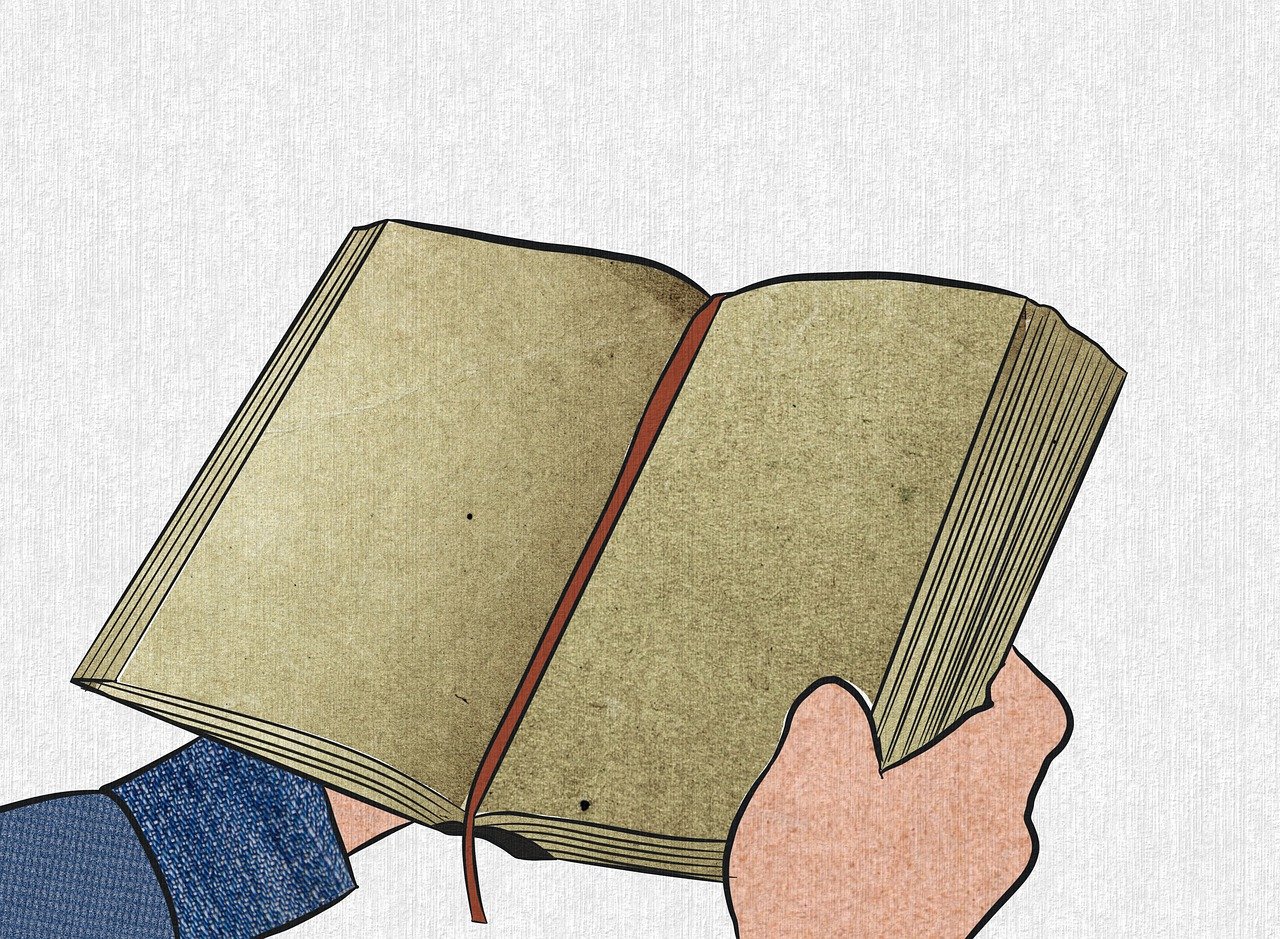Unser Buch des Monats April 2025

AIRBUS
Eine europäische Erfolgsstory
von Achim Figgen & Dietmar Plath
Diese gut bekannten Autoren bauen auf ihrem früheren Werk 50 Jahre Airbus auf. Vorweg: Ich bin begeistert von ihrer Präzision und klaren verständlichen Sprache. Es gelingt Ihnen, komplizierte technische, wie auch wirtschaftspolitische Sachverhalte auf ihren Kern zurück zu führen und so gut verständlich zu machen, Chapeau!
Es beginnt mit der komplizierten europäischen Luftfahrt-Nachkriegshistorie, mit der damaligen Kleinstaaterei und deren „Mini-Firmen“, kaum für den Weltmarkt geeignet, und zeigt dann die wichtigen Figuren in politischer wie technischer Hinsicht. Um nur zwei hierzulande einigermaßen bekannte Persönlichkeiten zu nennen: den mächtigen Franz-Josef Strauß und den genialen Flugzeugingenieur Felix Kracht auf deutscher Seite. Gerade der nachwachsenden interessierten hiesi-gen Fliegergemeinde kann so gut das Wesentliche der dama-ligen Luftfahrtzeiten vermittelt werden.
Nach den Geburtswehen um den Airbus A300, noch von vielen Firmen im Verbund entwickelt und gebaut, kommt man dann allmählich zu MBB/DASA/VFW hierzulande, BAe im UK, CASA in Spanien und AEROSPATIALE in Frankreich zur zentralen europäischen Firma EADS, die dann letztendlich den Typennamen ihres Flugzeuges AIRBUS zum Firmennamen machte und trotz vieler Rückschläge ein konkurrenzfähiger und gewinnbringender Produzent von erstklassigen Großflugzeugen wurde, dem Riesen Boeing der USA gut auf den Fersen.
Auf die A300 mit ihren diversen Untertypen kommt es zur A310 und daraus später zur A330, deren Tragflügel so gestaltet wurde, dass daraus ohne großen Aufwand die vierstrahlige A340 werden konnte.
Und es wird expliziert erklärt, warum (die aus heutiger Sicht kaum notwendige Idee) die 4 Triebwerke überhaupt sein mussten bei ähnlicher Reichweite der beiden Typen: Die später gesenkten Anforderungen zum Einmotorenflug über See („ETOPS“) ließen damals wegen der noch nicht klaren Dauerzuverlässigkeit der Triebwerke einen Flugbetrieb über „den großen Teich“ mit den zweimotorigen A330 noch nicht zu.
Dann erfahren wir die Geschichte der A320, dem Kurz- und Mittelstrecken-Airbus, der heute in seinen verschiedenen Variationen „das Brot- und Butterflugzeug“ von Airbus ist. Sein Hauptkonkurrent war die aus den 60er Jahren stammende Boeing B-737, noch in alter solider Technik entwickelt und gebaut, mit langen mechanischen Seilzügen, Stoßstangen und Umlenkrollen von den Steuerorganen hin zu Rudern und Klappen u.v.a.m..
Und genau da setzten die Airbus-Ingenieure an: Das aus der Militärfliegerei bereits bekannte Verfahren, die Steuerbefehle anstatt mit einem mittigen Steuerhorn die Impulse mechanisch mit den o.g. Werkzeugen zu übertragen – jetzt mit einem „Side Stick“ (Seitenknüppel) an einen Computer zu geben, der dann die berechneten Befehle über elektrische Kabel an die Stellmotoren der Steuerorgane weiter gab, führt zu einer deutlichen Gewichtseinsparung und vielen anderen Vorteilen. Das System hieß: FLY BY WIRE, also Fliegen mit Hilfe von Elektrokabeln (anstatt Seilzügen) und revolutionierte nun den Flugzeugbau. Das wurde danach bei allen Airbus-Airlinern eingeführt und von vielen anderen Herstellen übernommen. Ein Problem der Boeing 737 als Konkurrenz für die A320 ist dabei, dass deren Modernisierung heftige technische und aerodynamische Probleme bereiten sollte und von den Boeing Kaufleuten ignoriert wurde, was zu schwersten Problemen führte.
Die A320 mit all ihren Untertypen und Weiterentwicklungen wurde „DER“ Erfolgstyp von Airbus, die Bestellungen häufen sich und können kaum abgearbeitet werden, zumal die Lieferketten nicht nachkommen.
Dann folgt als neuerer Typ die A380 – der Großraumflieger, der bald wegen seiner 4 Triebwerke unwirtschaftlich wurde (weil hier die neuen zweimotorigen Airliner deutlich günstiger waren bei ähnlicher Leistung wie z.N. Boeing 787, Boeing 777 oder der hauseigene Airbus A350 XWB und sogar jetzt auch die A330 neo!). Die dann folgende Coronakrise im Luftverkehr gab der A380 dann den Rest – nur die Lieferengpässe der „Neuen“ hält den Luftverkehr mit ihnen noch ein wenig aufrecht.
Die A350 sollte zunächst eine weiterentwickelte A330 werden, was aber auf entschiedenen Kundenprotest stieß. So musste Airbus dann – mit Blick auf Boeings neuen CFK-Flieger B-787 das gesamte Programm ändern und aus der A350 (= A330 „neu“) wurde so die A350 XWB („EXtra Wide Body“), was einen deutlich breiteren Rumpf bedeutet und so mehr Passagiere aufnehmen kann.
Und dieses Konzept fand dann bald Anklang und entwickelt sich zu einem großen Erfolg. Als Fußnote ist dabei zu beachten, dass auch der A330 neo weiterhin große Erfolge hat und über seine Militär-Luft-Tankerversion A330 MRTT das Programm zu neuen Verkäufen führt.
Ende der 10er Jahre übernahm man dann von der kanadischen Firma Bombarderen Airlinerkonzept der C-Serie als Airbus A-220. Bombardier hatte sich damit verhoben. Sie soll als Typ langfristig die kleineren A320-Abkömmlinge ersetzen, tut sich aber noch schwer damit.
Auch der Airbus Beluga als großer Transporter aus erst A310 und späterdeutlich größer aus A330 in alter und neuer Ausführung wird genauestens beschrieben einschließlich mit dem Werksflugbetrieb.
Und auch das Sorgenkind A-400 M, der Militär-Transporter, wird genau behandelt in seiner z.T. sehr sorgenvollen Entwicklung: „Viele Köche verderben den Brei“ sagt der Volksmund, und hier sind es die mannigfaltigen von den Bestellern geforderten Abweichungen und Sonderentwicklungen, die nie endeten und alles maßlos verteuerten. Jetzt endlich scheint sich das alles aufzulösen, aber die große Bestellwelle bleibt bisher aus, das Programm ist gefährdet. Bei der Luftwaffe scheint sich dieser Flieger jetzt so langsam zu bewähren.
Schlussendlich befasst sich das Buch noch mit all den angedachten Projekten wie z.B. Wasserstoff- oder E-Fliegerei, aber da ist noch lange nichts entschieden.
Bei allem Lob habe ich dann doch noch eine mir unverständliche Kleinigkeit an den Autoren zu bekritteln: Als in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im metrischen System Zentral-europas sozialisierter Mitmensch habe ich meine Schwierigkeiten mit den Schubleistungsangaben der hier genannten Triebwerke. Die werden ausschließlich in (britisch/-US-amerikanischen) pounds (1 = ca. 460 g) benannt, mit Kilo-Newtons (kN) in Klammern dahinter. Bei den Massenangaben und Abmessungen wurde allerdings dann aussschließlich metrisch berichtet. Ich habe keinen vernünftigen Grund gefunden, den Schub nicht in kG (Kilogramm) zu benennen, die Massen aber schon, ich denke, das verwirrt den mit den 12er Maßen unbeleckten Leser.
Wilfried Crome (Jahrgang 1940), Luftfahrtmuseum Hannover, 03/25
Wer mehr zum Buch wissen will, der klickt hier!
Kontakt zum Autor der Buch-des-Monats-Reihe können Sie hier aufnehmen: Buchautor